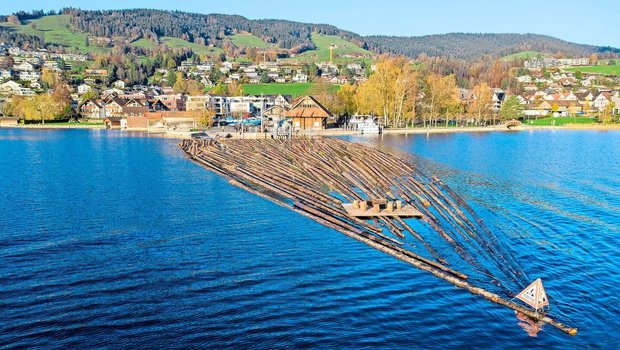Bern Er gehört zu den erhabensten Geschöpfen in den Schweizer Wäldern. Die Rede ist vom Rothirsch. Seit seiner Ausrottung vor rund 150 Jahren erobert er sein angestammtes Gebiet zurück. In einigen Randkantonen wie beispielsweise Graubünden, Tessin und Wallis gehört er schon lange wieder zur etablierten Fauna. Sein Comeback ist aber noch nicht abgeschlossen.
An die Hirsche gewöhnt
Vielerorts haben sich die Landwirte mit den Hirschen in ihrem Gebiet arrangiert. Ferdinand Oehrli ist Ackerbaustellenleiter der Gemeinde Sigriswil BE und Landwirt. Auf seinem Betrieb auf 1200 m ü. M. ist er des Öfteren mit dem Hirsch konfrontiert. Die letzten sieben Jahre hat er Schadensmeldungen wegen Frassschäden verursacht durch Hirsche beim Jagdinspektorat eingereicht. «Vor 10 bis 15 Jahren haben wir die ersten Hirsche in Natur gesehen», erzählt Oehrli. Das sei eine Sensation gewesen. Heute hat man sich längst an die erhabenen Tiere gewöhnt.
Dennoch hat er eine Veränderung in den vergangenen drei Jahren festgestellt. Früher seien vor allem grosse Herden nach dem Schnee über die Felder gegangen. «Heute habe ich den ganzen Sommer über kleine Herden in meinem Weideland», erklärt Oehrli. Jetzt sei hauptsächlich die Verschmutzung problematisch, die die Herde verursacht. Für Oehrli ist es wichtig, dass sich die Population in Grenzen hält.
Ausbreitung wird gefördert
Heute wird der Bestand in der Schweiz auf 36 000 Tiere geschätzt. «Die Rothirsche holen sich heute ihr angestammtes Gebiet zurück», sagte der Chef der Sektion Wildtiere und Waldbiodiversität im Bundesamt für Umwelt Bafu, Reinhard Schnidrig bereits vor drei Jahren gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Es gebe in der Schweiz noch Gebiete mit günstigen Bedingungen für den Hirsch, hält auch Pro Natura fest, wie beispielsweise das Mittelland, Jura und westliche Teile der Alpen.
«Die Rothirsche holen sich ihr Gebiet zurück.»
Reinhard Schnidrig, Chef Sektion Wildtiere und Waldbiodiversität beim Bundesamt für Umwelt
Dass sich der Hirsch aber auch im dicht besiedelten Flachland so wohl fühlt, das erstaunte auch Schnidrig. Als Beispiel sei hier der Hirsch «Ardy» aufgeführt, von dem man annahm, er habe sich im Mittelland «verirrt». Er wurde betäubt, mit einem Sender ausgestattet und im Jura wieder ausgesetzt. Man staunte nicht schlecht, als «Ardy» einen Monat später wieder in seinem Längwald zwischen Olten und Solothurn auftauchte. Notabene nach einer erfolgreichen Überquerung der A1 (die ganze Geschichte ist auf www.beobachter.ch nachzulesen. Stichwort: Die Rückkehr). Heute stehen Wildtieren über 300 Wildkorridore zur Verfügung, damit sie sich trotz besiedelten Gebieten weiter ausbreiten können.
Schäden in Wald und Wiesen
Mit seiner Ausbreitung Richtung Mittelland macht er sich nicht nur Freunde. «Bündner sollen mehr Hirsche schiessen», «In Obwalden geht es den Hirschen an den Kragen», «Hirsche fressen Kühen das Gras weg» lauten die Schlagzeilen. Sogar von Hirschplagen ist die Rede. Klar ist: Wo Wildtiere auftreten, ist über kurz oder lang die Landwirtschaft betroffen. Und je grösser die Anzahl, umso zahlreicher die Meldungen.
Der Grund ist klar: Wird die Populationsdichte zu gross, nehmen die Schäden an Wald und Wiesen zu. Im Kanton Graubünden, wo über 20 000 Hirsche leben sollen, sind auf 70 Prozent der Waldflächen Schäden feststellbar. Vor allem durch das Reiben des Geweihs an Bäumen oder durch das Abfressen von Trieben an jungen Bäumen kann der Hirsch erhebliche Schäden anrichten. Gerade dann, wenn die Wälder genutzt werden oder eine Schutzfunktion innehaben.
Auch Schäden in Weiden sind längst keine Neuheit mehr. Vor allem ins Gewicht fallen Frass- und Trittschaden, aber auch Verschmutzung durch Kot und Urin der weidenden Tiere.
Neu auch Schäden im Mais
Der Hirsch scheint bei der Nahrungsmittelsuche kreativer geworden zu sein. So weiss die BauernZeitung von mindestens einem Fall im Kanton Bern, bei dem der Hirsch ein Maisfeld beschädigt hat. Ein Novum? «Schäden durch Hirsche an Ackerbaukulturen fallen zur Zeit nicht ins Gewicht», erklärt Niklaus Blatter, Jagdinspektor des Kantons Bern. Den Rothirsch spüre man im Grasland und im Wald (siehe Nachgefragt).
Dass Maisfelder ein Schlaraffenland für Hirsche darstellen können, haben auch Einzeltierverfolgungen gezeigt, die mit Sendern durchgeführt wurden. Dort zeigte sich, dass sich einzelne Tiere tagsüber in Maisfeldern ausruhten, wo sie Sichtschutz hatten und genügend Nahrung.
Umzäunung teilweise möglich
Doch wie kann der Landwirt seine Felder schützen? Im Kanton Bern ist es beispielsweise möglich, Beiträge für aufwendigere Verhütungsmassnahmen von Wildschäden wie beispielsweise eine Umzäunung zu beantragen. Diese werden vorwiegend für Kulturen mit hohem Erntewert w. z. B. Erdbeeren oder Gemüse gesprochen.
Der Mais gehört nicht dazu. Die Umzäunung würde volkswirtschaftlich keinen Sinn machen. Ausserdem wolle man verhindern, dass die gesamte Kulturlandschaft eingezäunt und dadurch der Lebensraum für Wildtiere unnötig eingeschränkt werde, heisst es beim Jagdinspektorat.
Da sich der Hirsch nicht an Kantonsgrenzen hält, ist es wichtig, mit den Nachbarkantonen zusammenzuarbeiten. Das werde auch seit Jahren so praktiziert, sagt Philipp Amrein. Amrein ist Fachleiter Jagd und Fischerei vom Kanton Luzern. Er bezeichnet die Hirschschäden in der Landwirtschaft als eher gering und tragbar. «Bei uns werden vor allem Frass- und Trittschäden gemeldet, wenn im Frühling sehr nasse Witterung herrscht», erklärt er auf Anfrage. Hauptsächlich betrifft dies intensiv genutzte Wies- und Weideflächen entlang der Rotwild-Einwanderungsachsen vom Winter-in die Sommereinstände.
Der Kanton Luzern beobachtet eine gewisse Ausbreitung vom Entlebuch in Richtung Mittelland. «Eine natürliche Ausbreitung», wie Amrein erklärt. Das diesjährige Reduktionsziel beträgt 150 Tiere. Im Vergleich: 2004 sind 23 Stück Rotwild erlegt worden.
Jagdbanngebiete geöffnet
Die Population der Hirsche nimmt stetig zu. Wo die Anzahl eine ungesunde Grösse erreicht, wird reguliert. Wichtigste Massnahme ist die Jagd. Diese ist kantonal geregelt, sprich die Kantone geben die Abschusszahlen bekannt. Wird die Anzahl zum Abschuss freigegebenen Tiere nicht erreicht, kann eine Nachjagd beschlossen werden. Wölfe werden die Hirschregulierung laut Reinhard Schnidrig nie alleine übernehmen. «Das bräuchte garantiert mehr Wölfe als wir politisch ertragen», sagte Schnidrig gegenüber der SDA.
Eine weitere Massnahme be-steht in der teilweisen Aufhebung von Schutzgebieten. In der Schweiz gibt es 42 Jagdbanngebiete. Kritik wurde laut, der Schutz der Hirsche sei überholt und viel zu rigoros. Dieser Schutz wird nun teilweise aufgehoben. Beispielsweise im Justistal BE konnten letztes Jahr erstmals Hirsche gejagt werden.