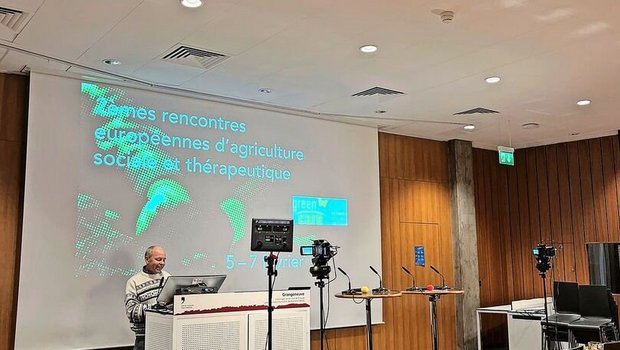Honig, Äpfel, Carefarming: Die handbeschriebenen Tafeln der Betriebe, die auf ihr Angebot hinweisen, werden voller – und sie werden anders. Neben tierischen und pflanzlichen Produkten kann mittlerweile auch die soziale Dienstleistung ein wichtiger Pfeiler des Betriebsergebnisses sein. Zumindest was den Arbeitsaufwand betrifft, denn in Sachen Entschädigung dieses sozialen Dienstes für die Gesellschaft ist noch Luft nach oben. Es wäre gefährlich, wenn sich ein Betrieb lediglich aus finanziellen Gründen für die Betreuung von psychisch labilen Personen entscheiden würde, aber man müsse dennoch davon leben können, moniert eine Fachperson im Rahmen eines Kurses zum Thema soziale und therapeutische Landwirtschaft. Im Vergleich zur Entlastung unseres Gesundheitssystems, die diesem bäuerlichen Angebot zu verdanken ist, scheint die Forderung nach einer fairen Entschädigung doch eher bescheiden. Die Eingliederung auf dem Landwirtschaftsbetrieb bietet Personen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und Stabilität brauchen, eine wichtige Stütze.
Der eigene Esel gibt einen Sinn zum Aufstehen
Zu diesem Schluss kommen verschiedene Studien aus unterschiedlichen Ecken. Die geregelte Tagesstruktur ist der bekannteste Pluspunkt dieses Modells. Das Gemeinschaftsgefühl, das einem eine Bauernfamilie geben kann, und die gemeinsamen Mahlzeiten sind weitere positiven Merkmale dieser sozialen Dienstleistung. Ein Anbieter erzählte im Kurs, dass er jedem Gast einen Esel in die Verantwortung gebe. Wenn es der Zustand der Person zulasse, sei es an ihr, zu schauen, wie es dem Esel gehe. «Das gibt der Person einen Sinn zum Aufstehen am Morgen», so seine Theorie. Sich um jemanden zu kümmern, statt immer denjenigen oder diejenige zu sein, um den oder um die man sich kümmern muss, könne für eine psychisch kranke Person befreiend sein, sind sich Fachpersonen einig. Das leuchtet ein.
Auf dem Landwirtschaftsbetrieb finden Personen mit psychischen Belastungen aus der therapeutischen Opferrolle heraus. Sie könnten «einfach Mensch sein», sagt ein Bauer im Gespräch. Er ist sicher, genau das ändert die Wahrnehmung einer Person, wenn sie sich beispielsweise um ein Tier kümmern kann, statt im Gesundheitswesen fortlaufend als Krankheits- oder Problemfall betrachtet zu werden. Die Bauernfamilien haben mit der Betreuung unterschiedlicher Personen begonnen, bevor die Studien zu ihren Faziten gelangt sind. Schon bevor der Begriff «Carefarming» in Mode kam, erkannten einige Bauern und Bäuerinnen die naheliegende Möglichkeit, ihre leerstehenden Räume sinnvoll zu nutzen: Sie nahmen Menschen auf, integrierten sie in ihren Alltag und boten ihnen so Halt und Unterstützung. Für manche kann diese altruistische Tätigkeit belohnend sein, andere sehen im Zusammenleben mit Menschen mit den verschiedensten Leidensgeschichten eine Chance.
Eine Bäuerin, die Gäste bei sich auf dem Betrieb aufnimmt, weiss, dass diese Menschen nicht nur Geschichten auf den Hof bringen, sondern die gemachten Eindrücke dann auch wieder in ihr Umfeld hinaustransportieren. Das ist zwar eine kleine Reichweite, in der das Verständnis für die Landwirtschaft steigen kann, aber es ist immerhin eine Reichweite. Durch diese Berührungspunkte mit der Aussenwelt helfen diese Menschen im besten Fall den Bauernfamilien, besser verstanden zu werden – und das ist in der heutigen Zeit viel wert. So viel, dass die Bauern und Bäuerinnen für die Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen auf dem Betrieb einen Gang herunterschalten, eine Sache mehrmals erklären und die Hausregeln neu aufsetzen.
Industrie ist nicht per se schlecht
Carefarming – ein altes Konzept in neuem Kleid also? Mit der Gründung der Dachorganisation Green Care versucht deren Vorstand, die Vermittlung von Plätzen und Betrieben zu vereinheitlichen und später sogar einmal ein Label zu lancieren. Letztlich ist es ein Service, den die Bauernfamilien anbieten. Und am Ende ist es eben auch eine «Industrie». Das ist per se nicht schlecht. Es ist für die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes schliesslich auch wichtig, eine erbrachte Leistung entsprechend zu entgelten. Je mehr diese Industrie aber heranwächst, desto genauer muss das Monitoring sein. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Freiburg: Das Konzept kann relativ einfach missbraucht werden. «Ça serve du Greenwashing», sagte die Dozentin an der Veranstaltung in Grangeneuve. Die Gefahr bestünde also, dass Betriebe mit dem Anbieten von Betreuungsplätzen ein verantwortungsbewusstes Image aufrechterhalten würden, ohne dem Versprechen gerecht zu werden. Das ist ein ernstzunehmendes Risiko, welches die zuständigen Organisationen auch angehen, wie sie beteuern.
In der Zwischenzeit darf die tiefe Entschädigung pro Gast auf dem Hof keine Schleuse sein, um Betriebsleitende mit den falschen Beweggründen von diesem Service abzuhalten. Wenn diese Bauernfamilien die stark überstrapazierten psychologischen Dienste unseres Landes – wenn auch zu einem kleinen Teil – entlasten, dann muss auch deren Entschädigung fair sein, auch wenn es für sie eine Herzensangelegenheit ist. Schliesslich ist das Betreuungs-Potenzial auf einem Betrieb riesig – oder kennen Sie eine Psychologin, die einen Esel im Behandlungszimmer hat?