Die amerikanische Firma Recombinetics hat gentechnisch hornlose Milchkuh-Stiere geschaffen. Durch einen Fehler tragen diese Tiere in jeder Zelle auch Bakteriengene, darunter drei Resistenzen gegen alte Antibiotika. Ob diese beispielsweise auf Darmbakterien übertragen werden können, ist schwer abschätzbar. Jedenfalls wirft der Fall Fragen auf zur Sicherheit in der Gentechnik. Schliesslich hat erst nach vier Jahren (und 17 Nachkommen) eine Aufsichtsbehörde den Fehler entdeckt. Wie ist der Stand der grünen Gentechnik in der Schweiz?
In Tierversuchen im Einsatz
Zwar sind gentechnisch veränderte Organismen (GVO) als Nutztiere bisher in der Schweiz kein Thema, in Tierversuchen sind aber bereits GVO-Mäuse im Einsatz. Tatsächlich werden seit 20 Jahren immer mehr von ihnen eingesetzt, vor allem zur Erforschung von Krebs und Autoimmunkrankheiten. Abseits von Tierversuchen konzentriert sich die Diskussion in der Schweiz vor allem auf Gentech-Pflanzen.
Keine GVO-Lebensmittel
Gegenwärtig gibt es auf dem Schweizer Markt laut dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) praktisch keine Gentech-Lebensmittel. Dies liegt vor allem an der schweizerischen Skepsis gegenüber GVO und weniger an der Gesetzgebung. Denn obwohl der Anbau von Gentech-Pflanzen nur zu Versuchszwecken erlaubt ist, sind Importe von Lebens- und Futtermitteln mit einer Zulassung des Bundes erlaubt. Somit könnten Schweizer Bauern also GVO-Futter verfüttern, laut Bundesamt tun sie es aber nicht. Auch die drei für Lebensmittel zugelassenen Mais- und eine Sojasorte findet man nicht im heimischen Supermarkt-Regal. Sie müssten nach Deklarations-Vorschrift gekennzeichnet werden und würden wohl nicht gekauft.
Quasi mit Fleisch importiert
Die Schweiz ist aber nicht unberührt von GVO. Gerade in Nord- und Südamerika wird im grossen Stil Gentech-Futter verfüttert und das resultierende Fleisch auch in die Schweiz importiert. Da dieses Endprodukt selbst nicht gentechnisch verändert ist, unterliegt es nicht der Deklarationspflicht. Einen Hinweis gibt einzig die Herkunft.
Akzeptabel, wenn nützlich
Die Akzeptanz von GVO-Produkten hängt zu einem Grossteil vom empfundenen Nutzen ab. Zu diesem Schluss kam eine Untersuchung im Rahmen des Nationalen Forschungsprojekts Nummer 59 (NFP 59), das sich von 2007 bis 2011 mit Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen beschäftigte. Für den Konsumenten war GVO akzeptabler, wenn die Produkte billiger waren. Bei den befragten Landwirten (60 Bauern aus dem Kanton Zürich) stieg die Anbaubereitschaft mit der erwarteten Arbeitsreduktion. Aber auch die allgemeine Meinung für oder gegen Gentech-Pflanzen spielte für die Befragten eine Rolle, wie auch im Falle der Landwirte die Frage, ob der Nachbar GVO anpflanzt oder nicht.
Knackpunkt ist die Ökologie
Neben Meinungen und Preis spielt aber die Ökologie mit bei einem Entscheid für oder gegen Gentech-Pflanzen. Die ist bisher ein Knackpunkt, denn es fehlen Langzeit-Erfahrungen. Grundsätzlich sind Ökosysteme enorm komplex und können grossen Schaden nehmen. Gerade weil nicht alle Pflanzen ihre Gene für sich behalten. So könnten Resistenzgene etwa auf verwandte Wildpflanzen (oder Acker-Unkräuter) übertragen werden.
Im Schlussbericht zum NFP 59 steht, gentechnisch veränderte Pflanzen könnten positiv sein, etwa wenn dank resistenter Obstsorten weniger Streptomycin gegen Feuerbrand eingesetzt werden müsste. Aber auch die anderen Teile des Ökosystems entwickeln sich weiter und können sich an gentechnisch eingeführte Resistenzen oder Gifte (etwa Bt-Toxin gegen Insekten in Pflanzenteilen) anpassen und sie so wirkungslos machen.
Cis- oder transgen?
Bei der Gentech-Diskussion muss zwischen cis- und transgenen Organismen unterschieden werden. Im ersten Fall stammt das eingefügte Gen aus derselben Art oder einer mit der Zielart kreuzbaren. Solche Pflanzen oder Tiere könnten also theoretisch auch auf natürlichem Weg entstehen. Bei transgenen GVO ist dies nicht der Fall, weil Gene aus anderen Arten oder Lebensformen zum Einsatz kommen. Die eingangs erwähnten hornlosen Rinder hätten cisgen mit der Hornlosigkeit sein sollen, sind nun aber transgen.
Bisher weder ökologisch noch wirtschaftlich
In Sachen Wirtschaftlichkeit lohnen sich die heute verfügbaren Gentech-Pflanzen in der Schweiz nicht. Einen Vorteil brächten laut den Berechnungen des NFP 59 herbizidresistente Sorten, Verluste wären bei GVO mit Schädlings- oder Pilzresistenzen zu erwarten.
Kombinationen wären besser
Dabei spielen immer auch die Anbaubedingungen (etwa der Schädlingsdruck) eine Rolle. Vielversprechender für die Schweiz wären zukünftige Kombinationen verschiedener Resistenzen in einer Pflanze.
An der Agroscope werden aktuell GV-Weizen und -Gerste mit pflanzlichen Pilz-Resistenzen im Feld auf Biosicherheit, Robustheit und Nebenwirkungen untersucht.
Ökologisch konnten für GVO bisher kaum positive Effekte gezeigt werden. Nachforschungen diverser Umweltämter haben gezeigt, dass das Versprechen einer Pflanzenschutzmittel-Reduktion durch GVO im Ausland nicht eingelöst wurde. Im Gegenteil, auf Feldern mit Herbizid-resistenten Pflanzen wurden mehr Herbizide eingesetzt. Ausserdem führten GVO zu häufigeren Monokulturen.
Das Zusammenspiel machts
Gute Eigenschaften entstehen meist aus einem Zusammenspiel verschiedener Gene. Das ist schwierig künstlich herzustellen. Bisher kann man ausserdem schwer voraussagen, ob sich eine Genveränderung auch auf unerwartete Weise auswirken könnte.
Es gibt Alternativen
Das Vorsorgeprinzip ist in der Verfassung verankert und bei GVO auch in unseren Köpfen; bisher wurde das Gentech-Moratorium stets verlängert. Die Debatte beginnt erneut 2021, wenn das letzte ausläuft. Man erforscht und probiert auch andere Wege, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Es ist es fraglich, ob wir auf GVO setzen sollen, oder besser anderen Methoden den Vortritt lassen, die mit weniger Ungewissheit verbunden wären.













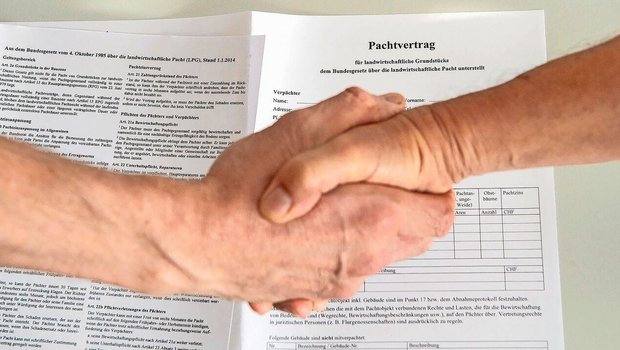


2