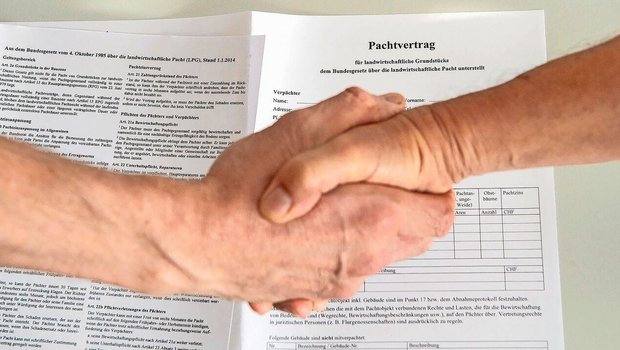Es war 2011. Ich war auf einer geplanten zwanzigstündigen Zugfahrt in China, schaute aus dem Fenster und sah dreizehn Stunden lang ausschliesslich Mais; Feld an Feld, Pflanze an Pflanze. Bei Gentechnik denkt man an Monokulturen Es sind Bilder wie diese, die man als Konsument oder Konsumentin mit einer auf Profit ausgelegten, entwurzelten Landwirtschaft verbindet. Hier dominieren Monokulturen, chemisch-synthetische…
Möchten Sie diesen Artikel lesen?
Lesedauer: 3 Minuten
Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.