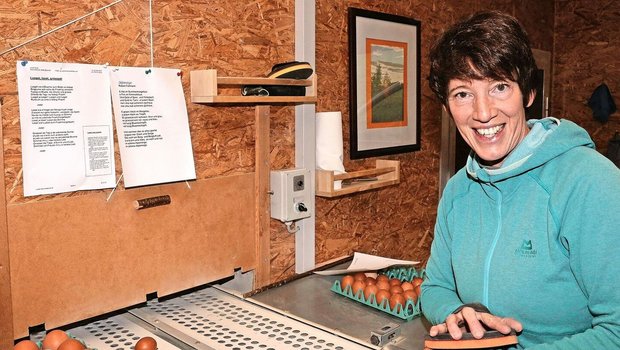Er war schon am Ende seines Referats, als Alec von Grafenried eine für ihn «erschreckende Zahl» nannte: Allein in der Stadt Bern fallen pro Jahr 100'000 t Abfall an, dazu 40'000 t Food Waste, der in der ARA verwertet werde. Damit gab der Berner Stadtpräsident einen Eindruck vom Ausmass der Problematik rund um Nebenstöme. Sie standen unter dem Motto «Nebenströme verwerten oder wie aus ›Müll‹ Innovation entsteht» im Fokus des dritten Berner Bio-Gipfels in Zollikofen.
Molke-Shake aus dem Käseland
Aussagekräftige Zahlen hatte auch Doris Erne im Gepäck: Rund 1,8 Millionen Tonnen Molke würden jedes Jahr in der Schweiz anfallen, sagte die Gründerin des St. Galler Start-Ups Wheycation. Bei einer Marktbeobachtung in ihrer Tätigkeit als Lebensmitteltechnologin drängte sich ihr eine Frage auf: «Warum steckt in den vielen Proteindrinks für Sportler im Käseland Schweiz keine Molke von hier?». Tatsächlich stehen der Nutzung inländischer Molke verschiedene Hindernisse im Weg, so Erne: Der hohe Wassergehalt macht sie schnell verderblich, ihre Haltbarmachung sowie die Logistik teuer. Auch ist die Produktion in den vielen kleineren Käsereien dezentral und die Qualität unterschiedlich. «Ausserdem ist die Nachfrage nach Molke klein – bis auf das Protein darin», ergänzt die Unternehmerin.
«Warum steckt in den vielen Proteindrinks für Sportler im Käseland Schweiz keine Molke von hier?»
Doris Erne sieht grosses Potenzial für die Nutzung von Schweizer Molke.
Molke und Ferien
Die Vermarktung sollen andere übernehmen
Der nächste Schritt wäre die Vermarktung, doch die sollten nach Meinung von Christoph Nyfeler «die Grossen» übernehmen. «Wir haben nur dann einen Impact, wenn die Grossindustrie mitmacht», ist er überzeugt. Nestlé, Coop oder Migros wären demnach am Zug. Bekanntlich ist es freilich nicht einfach, ein neues, veganes Produkt aus der Schweiz erfolgreich zu verkaufen. Das liegt aber nach Meinung von Christoph Nyfeler nicht (nur) an der Ware selbst: «Wir machen uns in der Industrie selbst das Leben schwer, weil nicht drin ist, was drauf ist». Der Unternehmer kritisiert, dass vielerorts ein Schweizer Kreuz auf der Verpackung sei, obwohl die Rohstoffe aus aller Welt kämen. Das macht es schwierig, ein durch und durch schweizerisches Produkt zu differenzieren.
Echte Kreislaufwirtschaft mit den Grossen
«Der Konsument weiss nicht, was er will – man muss es ihm sagen»: Mit dieser Haltung fordert Nyfeler vom Detailhandel, Neues im Regal auf attraktiver Höhe zu platzieren und es ausreichend lange im Sortiment zu behalten. Kritisch sieht er ausserdem hohe Magen, die biologische Produkte verteuern.
Für eine wahrhafte Kreislaufwirtschaft müsse man das nachhaltige System aber nicht nur der Kundschaft beibringen können, sie solle auch zum Standard bei den Grossen werden. «Und wir müssen auch zur Nutzung von Nebenströmen mit ihnen zusammenarbeiten», schloss Christoph Nyfeler.
«Der Konsument weiss nicht, was er will – man muss es ihm sagen»
Christoph Nyfeler wünscht sich von den Detailhändlern, dass diese neue Alternativprodukte attraktiv im Regal platzieren.
Die Ehefrau ist schuld
Ein veganer Hit in den SAC-Hütten
«Vegane Alternativen dürfen keine Strafe sein, sondern sollen schmecken», findet Adrian Koller. Wichtig sei auch die Preisparität zu Fleischprodukten, wobei das Protaneo-Ackerhack in Nährwerten und Preis Fleisch ebenbürtig sei.
«Vegane Alternativen dürfen keine Strafe sein, sondern sollen schmecken»
Geschmack, Preis und Nährwerte sind für Adrian Koller wichtige Kriterien bei veganen Produkten.
Trog statt Tonne: Erfahrungen mit dem Gemüseschwein
Als Best-Practice-Beispiel war am Bio-Gipfel der Betrieb Farngut aus Grossaffoltern BE eingeladen. Jonathan Bracher und Viviane Brönimann erklärten das dort umgesetzte Abo-System, das aus einer Kiste mit variablem Inhalt und der Option für freie Wahl im Hofladen besteht. Letzteres werde intern auch als «Gemüse-Flat-Rate» bezeichnet, da sich die Kundschaft dabei für einen monatlichen Betrag im verfügbaren Sortiment bedienen kann.
Plötzlich wurde der Preis gesenkt
Dass das Farngut voll auf die Karte Direktvermarktung setzt und auch eine grosse Anzahl Abonnent(innen) eines anderen Betriebs übernommen hat, ist nicht selbstverständlich. Betriebsleiter Markus Bucher ist nämlich als Bio-Knoblauch-Pionier bekannt geworden und hat dafür sogar den Agropreis gewonnen. «Seit Herbst 2021 ist der Knoblauch nicht mehr unser Hauptgeschäft», erläutert Jonathan Bracher. Einen Tag nach dem Setzen der Knollen habe sich der Abnehmer gemeldet und eine deutliche Preisreduktion angekündigt – ohne dass der Landwirt etwas dazu zu sagen hatte. «Da war für uns klar, dass wir fortan getrennte Wege gehen», so Bracher.
Schweizer Mitarbeiter?
Mit der anschliessenden Betriebsentwicklung stieg der Personalaufwand. Das Ziel des Farnguts ist ein diverser Anbau mit festen Fahrspuren zwischen den Beeten, 120 Kulturen im Streifenanbau auf einer Fläche von 8 Hektaren zusammen mit vielen Kleinstrukturen und Bäumen sowie Plätzen zum Verweilen. «Wir möchten nur Schweizer Angestellte», bemerkte Jonathan Bracher. Die hohen Lohnkosten sind hierbei aber ein Problem, weshalb der Landwirt eine offene Frage in den Raum stellte: «Ist es (noch) nicht möglich, Schweizer Mitarbeitende zu fairen Löhnen zu beschäftigen?».
Der zweite Best-Practice-Gast am Bio-Gipfel war Luzi Etter vom Biohof Wydihof in Unterseen BE. Auf dem 25-ha-Betrieb leben neben einer Herde Engadiner Schafe zur Beweidung von steilen Hängen 40-45 Kühe, 5-10 Aufzuchttiere und etwa 10 Weidemastremonten. «Wir haben uns schon länger mit der Homöopathie beschäftigt», erzählt Etter. Wegen unerwünschten Nebenwirkungen wie Resistenzbildungen oder reduzierter Gülleaktivität wollten er und seine Frau möglichst wenig Antibiotika einsetzen. «Ausserdem haben wir immer wieder Rückfälle nach Antibiotika-Behandlungen beobachtet.» Das Schlüsselerlebnis sei für sie gewesen, als es auf dem Wydihof gelang, mit Unterstützung des Vereins Kometian einen Ausbruch der Rindergrippe erfolgreich homöopathisch zu bekämpfen. Die betroffenen Kälber zeigten laut Luzi Etter auch als ausgewachsene Kühe keine Lungenschwäche, wie sie sonst häufig nach dieser Krankheit auftrete. Seither verzichtet die Bauernfamilie auf den Einsatz von Antibiotika bei ihren Rindern, was bei manchem Tierarzt eine gewisse Überzeugungsarbeit brauche. Das Tierwohl leide nicht darunter, betont der Landwirt und er gibt zu bedenken: «Es ist ja nicht so, dass wir keine Entzündungshemmer oder Schmerzmittel mehr nutzen.»
Viel und gut beobachten
Folgendes braucht es nach Erfahrung von Luzi Etter für gesunde Tiere ohne Antibiotika:
- Angepasste Kühe mit einer guten Grundgesundheit (seine Tiere geben 5’000 - 6'000 L Milch)
- Gutes Management, frühes Erkennen und Eingreifen im Krankheitsfall
- Genug Zeit zum Beobachten und eine gute Beobachtungsgabe
- Viel Beschäftigung mit Alternativen wie Homöopathie (Literaturstudium, Kurse)
- Unterstützung von der ganzen Familie
Antibiotikafreie Produkte vermarkten
Insgesamt stelle er weniger schwere Erkrankungen fest, sagt Etter. Das liege wohl an der intensiven Beobachtung des Gesundheitszustands der Tiere und dem schnellen Eingreifen bei ersten Krankheitssymptomen. Das Ziel des Wydihofs besteht nun darin, die ohne Antibiotika hergestellten Produkte auch entsprechend zu vermarkten.