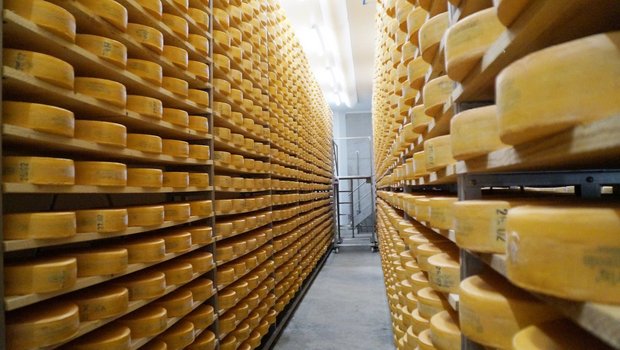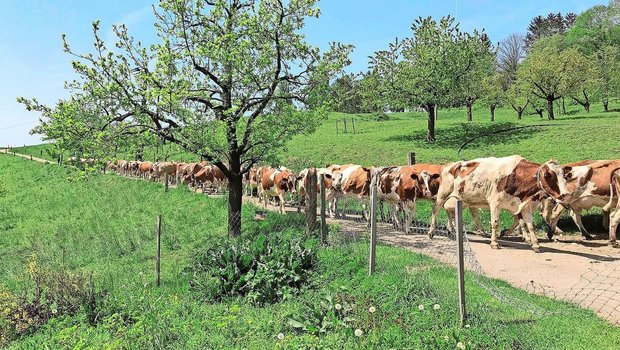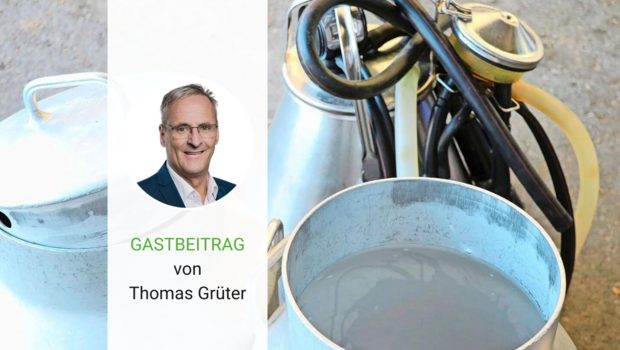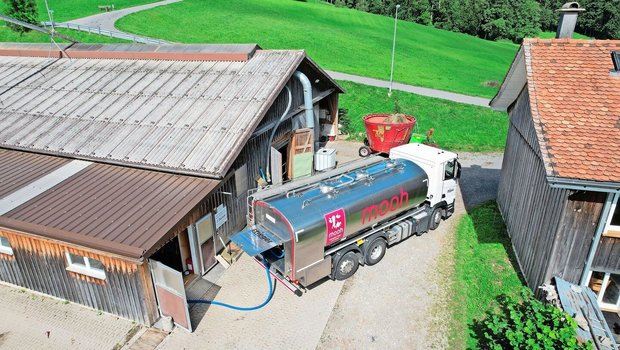Muss eine Milchkuh mit Antibiotika behandelt werden, darf ihre Milch nicht mehr in den Verkehr gelangen. Das stützt den betroffenen Landwirt in ein Dilemma, denn es handelt sich noch immer um ein nährstoffreiches Futtermittel, das aus wirtschaftlichen Gründen genutzt werden sollte. Das schreibt auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einem Merkblatt. Ausserdem ist Food Waste heute ein wichtiges Thema und «jeder Entsorgungsweg bringt Vor- und Nachteile mit sich».
Am Ende in der Umwelt
Rund die Hälfte der Sperrmilch werde in der Schweiz im Gülleloch entsorgt, so das BLV. Das ist einfach umsetzbar, fördere aber die Bildung von Resistenzen bei Bakterien in der Gülle, die bei der Ausbringung in die Umwelt gelangen. Ausserdem kann so der Nährwert der Milch nicht genutzt werden, was im Gegensatz dazu beim Verfüttern an Kälber oder Schweine auf dem eigenen Hof im Vordergrund steht. Zwar kommen Rückstände von Antibiotika so zwar nicht direkt aufs Feld, wohl aber indirekt über den Mist. Ausserdem können sie zu resistenten Darmbakterien führen. Ein Viertel der Sperrmilch landet nach Angaben des BLV im Futtertrog, was die «noch am wenigsten schlechte Wahl zu sein scheint».
Mit Bewilligung des Kantonstierarztes kann Sperrmilch auch vierfach verdünnt auf Felder ausgebracht werden. Die Problematik ist auch hier, dass Rückstände in die Umwelt gelangen.
Die Biogasanlage kann leiden
Weder in die Umwelt noch in Kälbermägen gelangt die Milch, wenn sie in einer Biogasanlage entsorgt wird. Resistenzen werden so nicht gefördert, dieser Weg ist aber mit grossem logistischem Aufwand verbunden. Verhältnismässigkeit und Machbarkeit seien wegen des Transports abhängig von der Situation, gibt das BLV zu bedenken. Ausserdem könne die Funktion der Biogasanlage gestört werden. Diese ist schliesslich auf Bakterien angewiesen und Antibiotika greifen genau diese Mikroorganismen an. Ausserdem können nicht alle Anlagen flüssiges Material annehmen, weshalb das Bundesamt empfiehlt, bei Interesse das Gespräch mit den Betreibern zu suchen.
Definitiv verboten ist hingegen, Sperrmilch in die Kanalisation zu leeren.
Rückstände könnten zerstört werden
Für die Entsorgung von Sperrmilch scheint es also keine wirklich gute Lösung zu geben. Es stellt sich die Frage nach Alternativen. Tatsächlich gibt es Ansätze, Rückstände von Antibiotika in der Milch unschädlich zu machen. «Am einfachsten wäre es, ohne die Milch wesentlich zu verändern, entsprechende Enzyme beizufügen», erläutert Mediensprecher Jonathan Fisch vom Bundesamt für Landwirtschaft auf Anfrage. Auf solchen Enzymen beruhen Antibiotikaresistenzen, sie sind also bekannt. Mindestens für die Forschung und zur Inaktivierung von Penicillin seien sie auch verfügbar, so Fisch. Das sei aber nicht für alle Antibiotikaklassen der Fall. Alle anderen Methoden wären laut BLW zu aufwändig und würden das Produkt Milch zerstören.
Zu grosses Missbrauchspotential
Der Grund, warum z. B. Penicillin-inaktivierende Enzyme nicht vermarktet werden, liegt im hohen Missbrauchspotential. Zu gross sei die Gefahr, dass Milch von ungenügender Qualität (keine Verkehrsmilch) abgeliefert wird. Auf die Frage, ob eine Zulassung angesichts der Resistenzproblematik nicht doch gerechtfertigt wäre, gibt Jonathan Fisch eine klare Antwort: «Nein, nicht einmal, um antibiotikahaltige Milch für die Kälber aufzubereiten». Niemand könne garantieren, dass solche Milch nicht in Verkehr gebracht wird. Auch sei das Risiko «viel zu hoch», wenn der Hemmstofftest beim Milchabnehmer positiv ausfällt und der Bauer eine ganze Tankladung zurücknehmen und entsorgen muss. Dass Kälber dank einem Enzym weniger Milch mit Antibiotikarückständen bekommen würden, lässt das BLW als Argument nicht gelten. «Bei der Verfüttung an Kälber kann kein direkter wirtschaftlicher Schaden entstehen.»
Auch im Ausland sei kein Einsatz von Enzymen zu diesem Zweck bekannt. Zwar schreibt das BLV, es müssten Lösungen für die heute bestehenden Hindernisse gefunden werden. Das BLW weiss aber von keinen entsprechenden Massnahmen, weder in der Schweiz noch im Ausland.
Hoffnung auf Innovation
Was bleibt, ist die Suche nach neuen Wegen. Möglich wäre etwa, Sperrmilch zu Kunststoff, Verpackungsmaterial oder Textilien zu verarbeiten. Dazu müsste der Rohstoff aber gesammelt und transportiert werden. Ausserdem fehlen häufig nahegelegene Infrastrukturen für die Verarbeitung. «Bis jetzt haben sich keine neuen Wege zur unproblematischen Verwertung durchgesetzt», hält das BLV fest.
Auf jeden Fall gilt die Devise, Antibiotika wann immer möglich zu vermeiden.
[IMG 2]Biopolymer aus deutscher Milch
Das deutsche Unternehmen Qmilk aus Hannover hat einige Bekanntheit erlangt. Es stellt Fasern, Folie und Granulat für Verpackungen aus Rohmilch her, die nicht lebensmittelkonform ist. Ausserdem bietet Qmilk für Peeling-Produkte winzige Kügelchen (Microbeads) an. Das Biopolymer wird aus dem Milcheiweiss Kasein hergestellt, womit man einen unvermeidbar anfallenden und bisher ungenutzten Rohstoff nutze. Laut Qmilk wurde Milch schon in den 30er-Jahren zu Textilien verarbeitet. Der damalige Prozess sei aber sehr energieaufwändig gewesen und es kamen verschiedene schädliche Chemikalien zum Einsatz. Qmilk-Produkte hingegen seien unbelastet sowie kompostiertbar und wurden schon mehrfach ausgezeichnet.