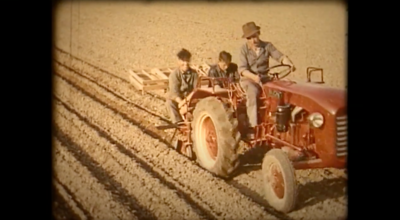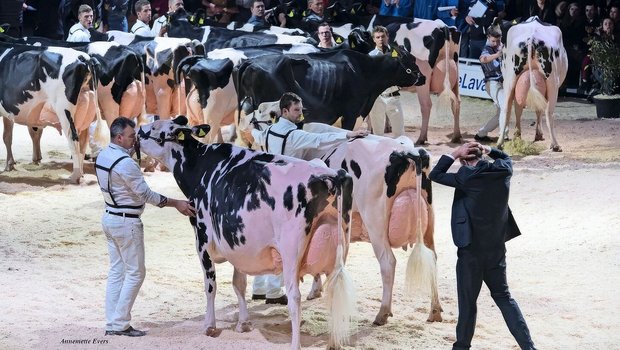1946 gründeten Mitglieder der Bauernheimatbewegung, bekannter als «Jungbauern», unter der Führung von Hans Müller die Anbau- und Verwertungsgenossenschaft (AVG, heute: Terraviva). Der wichtigste Abnehmer der AVG war die aufstrebende Migros, die von ihrem Gründer Gottlieb Duttweiler kurz zuvor in eine Genossenschaft umgewandelt worden war.
Müller und Duttweiler, die beide lange dem Nationalrat angehörten, waren nicht nur in der Politik Einzelgänger, sie bewegten sich in der Zwischenkriegszeit auch im wirtschaftlichen Bereich mit den von ihnen gegründeten Organisationen am Rande der dominierenden Kräfte. Es war deshalb naheliegend, dass die Gemüse produzierenden Jungbauern und die Migros nach dem Zweiten Weltkrieg miteinander ins Geschäft kamen – und bis in die frühen 1990er-Jahre eine solide Partnerschaft praktizierten.
Eine Prämie für Bio ausbezahlt
Als die Mitglieder der AVG 1948/49 begannen, nach den von Hans und Maria Müller sowie Hans Peter Rusch definierten organisch-biologischen Richtlinien zu produzieren, wurden sie von der Migros unterstützt. Die Migros zahlte der AVG Prämien für das Biogemüse, das sie in den Läden der Regionalgenossenschaften aber erst in den 1960er-Jahren als «Biogemüse» zu deklarieren begann.
Zehn Jahre später gab die spektakulär wachsende Migros diese Praxis jedoch schon wieder auf und entwarf mit dem Migros-Sano-Projekt («M-S») eigene Anbaurichtlinien für ihre Direktlieferanten. Das von der AVG bezogene Biogemüse verkaufte die Migros in den 1970/80er-Jahren nicht mehr als «Biogemüse», sondern unter dem Label «M-S».
Pierre Arnold wirkte als treibende Kraft
Die treibende Kraft hinter der Schaffung von «M-S» war Pierre Arnold. Der Agronom war vor seiner Tätigkeit bei der Migros als Direktor des Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbandes Union des Syndicats Agricoles in der Romandie tätig. Arnold unterstützte in den 1960er-Jahren die Entwicklung des organisch-biologischen Landbaus, wurde aber zunehmend skeptisch, weil die Lebensmittelbehörden von der AVG einen mit naturwissenschaftlichen Methoden erbrachten Nachweis verlangten, dass die «Bioprodukte» ohne Einsatz von Kunstdünger und «giftigen» Pflanzenschutzmitteln produziert worden seien.
Die Suche nach einem Mittelweg
Weil die Behörden seit dem späten 19. Jahrhundert mit der Lebensmittelgesetzgebung sicherzustellen versuchten, dass alle in den Verkauf gelangenden Lebensmittel hygienisch einwandfrei und gesund seien, erlaubten sie Produzenten und Verarbeitern von Nahrungsmitteln nicht, ihre Produkte als «besonders gesund» oder «gesünder» auszuloben. Auch eine Deklaration als «giftfrei» war nicht erlaubt, weil es keine allgemein anerkannte Definition von «giftig» gab.
Als der zunehmende Einsatz von Kunstdünger und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in den Medien vermehrt kritisiert wurde, die Nachfrage nach Gemüse aber aufgrund der Bevölkerungszunahme stark anstieg, suchte Pierre Arnold nach einem Mittelweg zwischen der «biologischen» und der «konventionellen» Produktion.
Im Frühling 1970 fragte die Migros ihre Mitglieder, ob sie künftig «vermehrt» Anstrengungen unternehmen solle, «damit die von ihr verkauften landwirtschaftlichen Produkte mit möglichst wenig chemischen Mitteln, Antibiotika und Pestiziden» produziert würden.
Richtlinien für Produzenten entwickelt
Nach der deutlichen Zustimmung der Genossenschafter begann man mit dem Aufbau von Labors zur Durchführung von Bodenuntersuchungen und der Entwicklung von Anbaurichtlinien, deren Umsetzung bei den Produzenten von rund einem Dutzend technischer Berater überwacht wurde. Die nun als «M-S» deklarierten Produkte wurden 1973 in den Migros-Läden lanciert. Als Migros-Sano-Produkte durften sie aufgrund der Lebensmittelgesetzgebung nicht bezeichnet werden, weil mit dem Begriff «Sano» suggeriert wurde, diese Produkte seien gesünder als die mit konventionellen Methoden hergestellten. Geprägt wurde das «M-S»-Projekt neben Pierre Arnold in den 1980/90er-Jahren insbesondere von Hans Peter Baertschi.
Gleiche Preise für beides
Obwohl die Genossenschafter 1970 entschieden hatten, dass die bei der Produktion, der Beratung und der Kontrolle anfallenden Mehrkosten mit einem bis zu 10 Prozent höheren Verkaufspreis abgedeckt werden könnten, wurden die «M-S»-Produkte in der Folge in den Läden zu den gleichen Preisen verkauft wie die «konventionell» produzierten.
Die Kosten für die Beratung, die Bodenanalysen und die Kontrollen trug der Migros-Genossenschaftsbund. Die Produzenten von «M-S»-Gemüse genossen bei den Einkäufern der Migros-Regionalgenossenschaften eine Lieferpräferenz, erhielten aber keinen Mehrpreis.
Das «M-S»-Programm wird aufgegeben
Aufgegeben wurde das «M-S»-Programm 1999/2000, weil inzwischen ein grosser Teil der Agrarprodukte nach den Richtlinien der integrierten Produktion (IP) hergestellt wurde. Aber auch, weil die Migros nun wieder begann, Biogemüse zu verkaufen. Biogemüse, das, wenn es nach den Knospe-Richtlinien von Bio Suisse produziert worden war, nun als Biogemüse angepriesen werden durfte, weil inzwischen auch die Lebensmittelgesetzgebung entsprechend angepasst worden war.